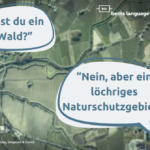Helau again! Es ist soweit, wir dürfen erneut Karneval feiern!
Und zur Feier werden wir (fast) alle am Rosenmontag ins Büro gekommen. Endlich dürfen wir wieder gemeinsam feiern, uns verkleiden und auf Karneval anstoßen.
Das Start-Datum des Straßenkarnevals ist jedes Jahr anders, immer gleich bleibt der Beginn der 5. Jahreszeit: Jedes Jahr am 11.11. pünktlich um 11 Uhr 11. Warum ist das so? Woher kommt der Karneval, warum feiern wir das überhaupt? Wie heißt es richtig? Welche Fakten gibt es? Und welche Terminologie darf verwendet werden? Das lesen Sie hier.
Die Wiege des Karnevals
Liegt laut Wikipedia in Mesopotamien, wo bereits vor 5.000 Jahren Karneval gefeiert wurde und zwar in Form eines sieben tägigen Festes nach Neujahr. Hier galt vor allem das Gleichheitsprinzip – alle waren in dieser Zeit einander gleich gestellt, Herren wie Diener, Frauen wie Männer. Außerdem durfte niemand bestraft werden und es wurde Essen und Trinken in Hülle und Fülle bereitgestellt. Dies sind bis heute Grundprinzipien des Karnevals. Auch die Ägypter und andere Hochvölker feierten Frühlingsfeste in ähnlicher Form.
Karneval hierzulande
Bei uns in Europa hat sich der Karneval erst ab dem Mittelalter mit dem kirchlichen Ritual der Fastenzeit etabliert. Erste Erwähnung des Karnevals – auch Fastnacht genannt – findet man in der Speyerer Chronik von 1612, dort ist zu lesen: „Im Jahr 1296 hat das Unwesen der Fastnacht etwas zeitig angefangen (…)“ 1341 wird das Wort Fastelovend (aus dem Kölschen: Fastnacht) im so genannten Eidbuch der Stadt Köln zum ersten Mal erwähnt. Was aber war der Grund für die Einführung des Karnevals?
Vor Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt und bis Ostern andauert, sollte nochmal ausgelassen gefeiert werden. Das ist auch der Grund, warum der Beginn des Straßenkarnevals fast jedes Jahr an einem anderen Datum ist: Er hängt vom Beginn der Osterzeit ab.
Aus dem gleichen Grund wurde ursprünglich am 11.11. (am Martinstag) ein zweiter, sogenannter ‚kleiner‘ Karneval gefeiert, nämlich der vor der vierzigtägigen Fastenzeit vor Weihnachten. Von hier stammt die Tradition, dass am 11.11. in vielen Gegenden der Sitzungskarneval beginnt, der den ‚janz jecken‘ Vereinskarnevalisten vorbehalten ist. In anderen deutschsprachigen Regionen ist der Dreikönigstag, also der 6.1., Start der Karnevalszeit.
Jecke Fakten
Drei Karnevalshochburgen bedeuten nicht nur verschiedene Terminologie, sondern auch viele verschiedene Fakten. Wir haben hier die 11 lustigsten, beeindruckendsten oder merkwürdigsten Fakten über die fünfte Jahreszeit und vor allem zum Rosenmontag zusammengetragen:
- Um 11:11 Uhr starten in Köln und Mainz die Rosenmontagszüge. In Düsseldorf geht es um 12:22 Uhr los.
- Mit 8,5 km Länge ist die Kölner Karnevalszugstrecke die längste, gefolgt von Mainz mit 7,2 km.
- In Mainz überragt die komplette Zuglänge die Strecke um fast 2 km.
- In Düsseldorf bewegt sich der Karnevalszug mit circa 2,5km/h durch die Innenstadt.
- Es kann unter Umständen teuer werden, wenn Kostümen (oder Waffen) bei Ritter:innen, Pirat:innen, Polizist:innen oder Soldat:innen zu echt aussehen.
- Köln ist die größte Karnevalshochburg in Deutschland und erwartet an Rosenmontag ca. 1,5 Millionen Besucher:innen.
- In Mainz wird in der fünften Jahreszeit die Fastnachtsflagge (Rot – Weiß – Blau – Gelb) gehisst, Legenden zufolge ist diese an die französische Trikolore angelehnt und geht auf die gemeinsame Geschichte zurück.
- Über 2000 Gläser Altbier werden allein in Düsseldorf an Altweiber pro Stunde gezapft.
- Rund 450 Tonnen Kamelle regnet es am Rosenmontag in Köln und Düsseldorf.
- Wer durch jeckes Wurfmaterial verletzt wird, hat laut Gesetzgeber keinen Anspruch auf Schadensersatz.
- Warum die Zahl 11 eine wichtige Rolle in allen Karnevalshochburgen spielt, ist nicht gänzlich geklärt, aber eine Erklärung könnte diese sein: Im Mittelalter kennzeichnete die Zahl 11 die „Sittenlosen“ und der Maßlosigkeit, vielleicht kommt daher die große Bedeutung der Zahl im deutschen Karneval.
Am 12.02. wird ab 9:30 Uhr der Kölner Zoch im WDR übertragen, ab 10:30 Uhr geht die Übertragung des Meenzer Zugs im SWR los und ab 15 Uhr gibt es wieder im WDR den Düsseldorfer Rosenmontagszug zu sehen.
Die richtige Terminologie: Karneval, Fasching, Fasnacht oder Fastelovend?
Wie bereits erwähnt haben wir in Deutschland drei große Karnevalshochburgen: Köln, Mainz und Düsseldorf. Natürlich wird in vielen Teilen des Südens auch Karneval gefeiert, aber auf eine andere Art. Doch wie geht es im westlichen Karneval zu?
In Kölle (Dialekt für Köln) feiern die Jecken Karneval, rufen Alaaf und an Rosenmontag regnet es Kamelle. Die meenzer (Dialekt für Mainzer) Narren und Närrinnen feiern Fastnacht oder Fassenacht mit einen dreifach donnernden Helau und dort lautet der Wetterbericht an Rosenmontag häufig „Wolkig mit Aussicht auf Handkäs‘!“ Hier in Düsseldorf sind wir auch jeck unterwegs und jubeln dieses Jahr mit einem besonders lauten Helau auf den Karnevalszügen.
Doch woher kommen eigentlich die Begriffe?
Woher kommt das Wort ‚Karneval‘? Die geläufigste Vermutung ist, dass es sich um eine Ableitung vom mittellateinischen carne levare (Fleisch wegnehmen) oder carnelevale als Bezeichnung für die Fastenzeit (Fleischwegzeit) handelt, sehr gut möglich ist auch eine Übersetzung von carne vale im Sinne von Fleisch, lebe wohl! Und warum dann Fastnacht?
Wir wissen es geht in der 5. Jahreszeit darum, vor der Fastenzeit nochmal ordentlich zu feiern, daher hat sich in der rheinhessischen Region das Wort Fastnacht aus dem mittelhochdeutchen vas(t)(en)nacht abgeleitet. Das bedeutete damals so viel wie „die Nacht vor dem Fasten“. Übrigens kommt Fasching von vastschang (Ausschank des Fastentrunks). Man kann also festhalten, dass diese schillernde und bunte 5. Jahreszeit – egal, wie man sie nennt – ursprünglich immer mit der darauffolgenden Fastenzeit zu tun hat.

Helau oder Alaaf?
Obwohl der Karnevalsgruß Alaaf Deutschland weit bekannt ist – unter anderem aufgrund der notorischen Fernsehübertragungen zahlreicher rheinländischer Sitzungen und Züge – wird er nur im Rheinland ausgerufen. Alaaf lässt sich auf den Trinkspruch aus dem 15. Jahrhundert zurückführen: „Al Aff“ (Bedeutung: Nichts geht über). Seit dem 19. Jahrhundert etablierte sich der Ausruf: „Kölle alaaf!“, was so viel, wie „nichts geht über Köln“ bedeutet. In Düsseldorf hingegen, als rheinländische Ausnahme, ruft man Helau und im restlichen Deutschland fast durchgängig ebenso. Woher dieser närrische Ruf kommt lässt sich nicht genau sagen. Weitere Karnevalsgrüße haben sich an zahlreichen Ortschaften entwickelt, wie z.B. Narri-Narro im süddeutschen Raum.
Fazit: Wir können feststellen, dass es viele Begriffe gibt, die alle richtig und zulässig sind. Ein einziges „richtig“ gibt’s hier also nicht: Der Karneval ist so vielfältig wie unsere Bundesländer und lebt nicht nur vom Dialekt sondern auch von den Besonderheiten der Bewohner. Deshalb gibt es so viele Namen für den Karneval wie es Karnevalshochburgen gibt.
Terminologisch betrachtet gibt es keine abgelehnten Begriffe, nur bevorzugte je nachdem in welcher Region man sich befindet. Nun noch ein kurzer Überblick über:
Und nun die wichtigsten Tage...
Der 11.11. (Karnevalsbeginn), Karnevalsdonnerstag (Weiberfastnacht, wo das Weib die Macht hat) und Rosenmontag sind die wichtigsten Tage im Karneval, zumindest bei uns im Rheinland :-). Der Tag des großen Karnevalszugs, der mancherorts auch dienstags stattfinden kann, ist der Höhepunkt des Karnevalsgeschehens und ein mediales Ereignis. Aber der wirkliche Karneval findet auf der Straße und in den Kneipen statt. Der Aschermittwoch ist wichtig, weil der Spaß da vorbei ist. Katholische Karnevalisten erhalten das Aschekreuz in der Kirche und die Fastenzeit beginnt. In Köln wird traditionell am Dienstag um Mitternacht eine Strohpuppe, Nubbel genannt, verbrannt, sinnbildlich für alle Sünden des Karnevals oder darüber hinaus. In Düsseldorf und niederrheinischen Städten wird zum gleichen Zwecke der Hoppeditz (eine Narrenfigur) zu Grabe getragen. Deswegen begeht man in diesen Gegenden zu Beginn der Karnevalszeit das Hoppeditz Erwachen.
Es gibt unzählige Mythen und Geschichten um den Karneval, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in Europa und in der ganzen Welt. So viele, dass man sie nicht in einem Blog erfassen kann.
Wichtig ist, dass Sie durch unseren Blog nun wissen, wo Sie was rufen sollten.
Wenn Sie wissen möchten, wie Ihre Terminologie in Ihrem Unternehmen aussehen kann und, wie man richtig damit umgeht, sind Sie bei uns genau richtig, denn wir kennen uns nicht nur mit närrischer Terminologie gut aus, sondern können Sie bei Ihrem Terminologieproblem beraten.
Kontaktieren Sie uns gerne zum Thema Terminologiemanagement in Ihrem Unternehmen!
Zum Schluss noch ein kleines „Schmankerl“ aus 2024 mit unseren rockigen Kostümen. Und wer sich musikalisch noch nicht von Karneval trennen möchte, kann gerne unsere karnevalistische Büro-Playlist anhören und mitschunggele 😉

Das blc-team wünscht allen Jecken und Jeckinnen eine ausgelassene Karnevalszeit! Und nicht vergessen: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!